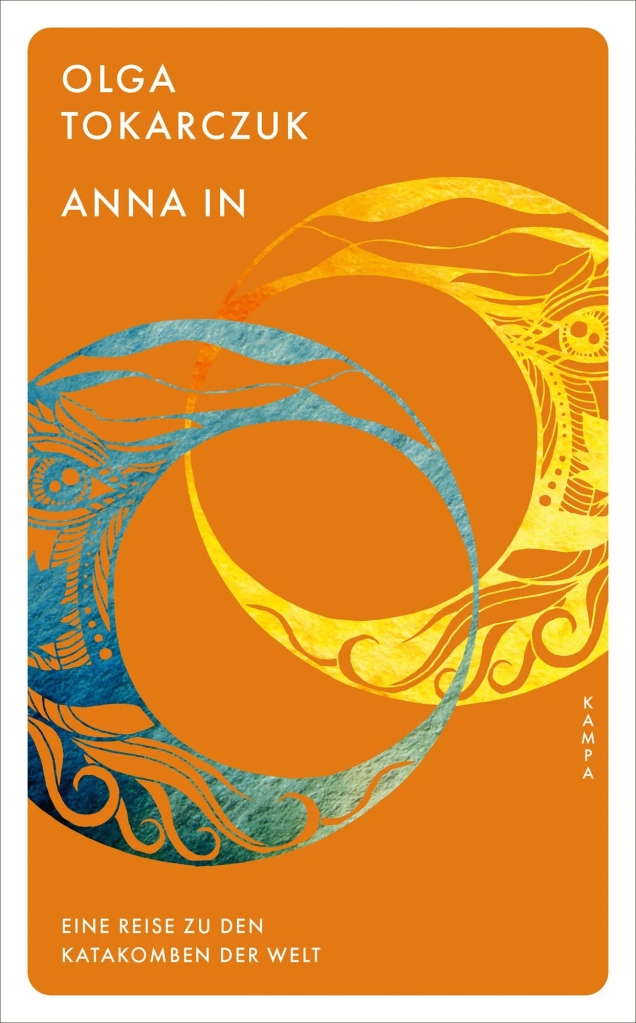Wie oft stirbt ein Mensch im Laufe seines Lebens? Und was ist nötig, damit er sich selbst überlebt? Diese Fragen thematisiert die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk in ihrem Roman “Anna In”.
Die Stadt, in der die Geschichte spielt, ist auf Ruinen erbaut, darunter liegen die Katakomben. Das sind zwei Welten: Die Stadt ist die Welt der Lebenden und die Katakomben die Welt der Toten und der Dämonen. Um die Katakomben zu betreten, muss man ein ehernes Tor passieren. Einlass wird nur denjenigen gewährt, die zum Tode bestimmt sind. Doch stärker als durch die räumliche Trennung, die durch das Tor versinnbildlicht wird, sind die beiden Welten durch ein unumstößliches Gesetz voneinander getrennt: Wer die Katakomben betritt, kehrt nicht mehr in die Stadt zurück.
Eine Reise an die Grenzen des Seins
Zu Beginn des Romans lernen wir die Titelheldin Anna In kennen, sie ist eine Göttin der Liebe und des Krieges und herrscht über die Stadt. Doch erzählt wird die Geschichte nicht von ihr, sondern von einer Vielzahl anderer Stimmen. Eine von ihnen ist Nina Šubur, die sich als “Ich-Jede” vorstellt, ein gewöhnlicher Mensch. Sie ist eng mit Anna In befreundet. Gemeinsam brechen sie zu einer Reise auf, doch Anna In weigert sich, das Reiseziel zu verraten. So folgen sie den weit verzweigten metallenen Pfeilern, auf denen die Stadt errichtet ist, und die die unterschiedlichen Ebenen der Stadt zusammenhalten. Aufzüge und Treppenspiralen verbinden die Stadtteile miteinander. Es gibt auch Rikschas, von stummen Rikscha-Fahrern betrieben, die auf den Fahrsteigen dahinjagen und rasch von Ebene zu Ebene springen können. Doch Anna In und ihre Freundin folgen dem labyrinthartigen Aufzugsystem. Mit einer Karte und einem Kompass ausgerüstet, steigen sie in Aufzüge ein und werden anderswo wieder ausgespien, nur um bald in den nächsten Aufzug umzusteigen. Über kurz oder lang stellt sich heraus, wohin es Anna In zieht, nämlich zu den Katakomben. Als sie am ehernen Tor zum Totenreich angelangt sind, berichtet Anna In, dass ihre Zwillingsschwester, die Herrscherin des Totenreichs, sie gerufen hat. Anna In hat die leidvolle Klage ihrer Schwester in ihrem Innern vernommen: “Seit Tagen höre sie ihre Stimme, vielfach zurückgeworfen vom metallenen Skelett der Stadt, widerhallend in den Labyrinthen ihrer Ohren, der Hammer auf dem Amboss tönend wie eine Glocke.” (34) Es ist ein Rufen, dem sich Anna In nicht erwehren kann. Es ist der Ruf ihrer Schwester, der in ihr widerhallt. Die Schwestern sind vereint als Stimme und Resonanzkörper. Nina Šubur leuchtet diese besondere Verbindung ein: “Schwestern müssen schließlich eine Verbindung spüren, müssen sich verstehen […].” (35) Und so folgt Anna In dem Ruf ihrer Schwester und verschafft sich gebieterisch Zugang zu den Katakomben.
Zwischen Kühnheit und Leichtsinn
Die Kühnheit, mit der Anna In Einlass zum Totenreich fordert, verblüfft nicht nur den Torwächter. “Weißt du auch, was du da tust?”, fragt dieser, nachdem er sie eingelassen hat, und wird für einen kurzen Moment von dem Drang übermannt, “dieses leichtsinnige junge Ding zu packen und wieder vor die Tür zu befördern” (41). Anna In hat das Totenreich betreten, ohne zum Tode bestimmt zu sein. Über die Konsequenzen ihres Handelns scheint sie sich keine Gedanken zu machen. Der Torwächter fragt sich stumm: “Weiß sie, welche Strafe sie dafür erwartet? Es gibt keinen Weg zurück, sie ist so gut wie tot, das dumme Ding.” (47) Nimmt Anna In den Tod willentlich in Kauf, um ihrer Schwester zu helfen? Diese Frage wird nicht eindeutig beantwortet. Es liegt aber nahe, dass sie sich eine solche Frage gar nicht gestellt hat. Es war das Nächstliegende, der Schwester Beistand zu leisten; eine Verpflichtung, die sie übernimmt, ohne darüber nachzudenken. Dies wird ihr jedoch zum Verhängnis.
Die Ein-Person-Rettungsaktion
Als Anna In nach drei Tagen nicht aus den Katakomben zurückgekehrt ist, startet ihre Freundin Nina Šubur, die vor dem ehernen Tor gewartet hat, eine Ein-Person-Rettungsaktion. Ihre Verzweiflung wächst mit jedem Anlaufpunkt, den sie ansteuert, und mit jedem Bittgesuch, das abgelehnt wird. Sie wird bei Anna Ins Liebhabern, Friseuren und Köchen vorstellig, ohne Hilfe zu erhalten. Selbst Anna Ins drei Götterväter weisen sie ab. Einer der Väter urteilt hart: “Sie aber, Anna In, ist nicht in der Lage sich anzupassen. Sie ist asozial, agöttlich. Eine Diebin und Trinkerin. […] Eine Krawallmacherin.” (69) Am Ende beruft sich der Vater auf das Gesetz, das die Lebenden und die Toten voneinander scheidet: Niemand kann von den Katakomben in die Stadt zurückkehren. “Ich kann sie nicht über das Gesetz stellen.” (69) Dieses Gesetz gleicht der Schöpfungsordnung: Was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben; was lebt, muss einmal sterben. Die Rückkehr der Toten zu den Lebenden ist in der Schöpfungsordnung nicht vorgesehen. Man kann dem Vater zugestehen, dass die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung nicht zur Disposition stehen.
Hier stellt sich die Frage, was die Familie von Anna In zusammenschweißt. Ist es das Gesetz? Für Anna In selbst spielte das Gesetz keine Rolle, als sie zu ihrer Schwester ins Totenreich eilte. Das mag als unbesonnen gelten: “Alles, was sie tut”, sagt ein anderer der Götterväter, “tut sie unbesonnen.” (61) Aber es ist auch ein Hinweis darauf, dass es nicht das Gesetz ist, das die Schwestern miteinander verbindet. Vielmehr spürt Anna In eine intuitive, unreflektierte Verpflichtung, der Schwester zu helfen. Eine Verpflichtung, die das Gesetz missachtet.
Eine neue Ordnung
Am Ende des Romans wird nicht das Gesetz das letzte Wort haben. Stattdessen wird ein anderes Wort wichtig werden: Mitleid. Aus Mitleid werden manche der Protagonisten den Tod auf sich nehmen und aus Mitleid wird ihnen ein neues Leben geschenkt werden. In Tokarczuks Roman stirbt ein Mensch im Laufe seines Lebens mitunter viele Male. Was es möglich macht, dass er sich selbst überlebt, ist die Solidarität mit Weggefährten, die in ihrem Handeln nicht auf das Gesetz beschränkt bleiben.
Olga Tokarczuk: Anna In. Eine Reise zu den Katakomben der Welt, Kampa Pocket 2024, ISBN 978 3 311 15055 8.