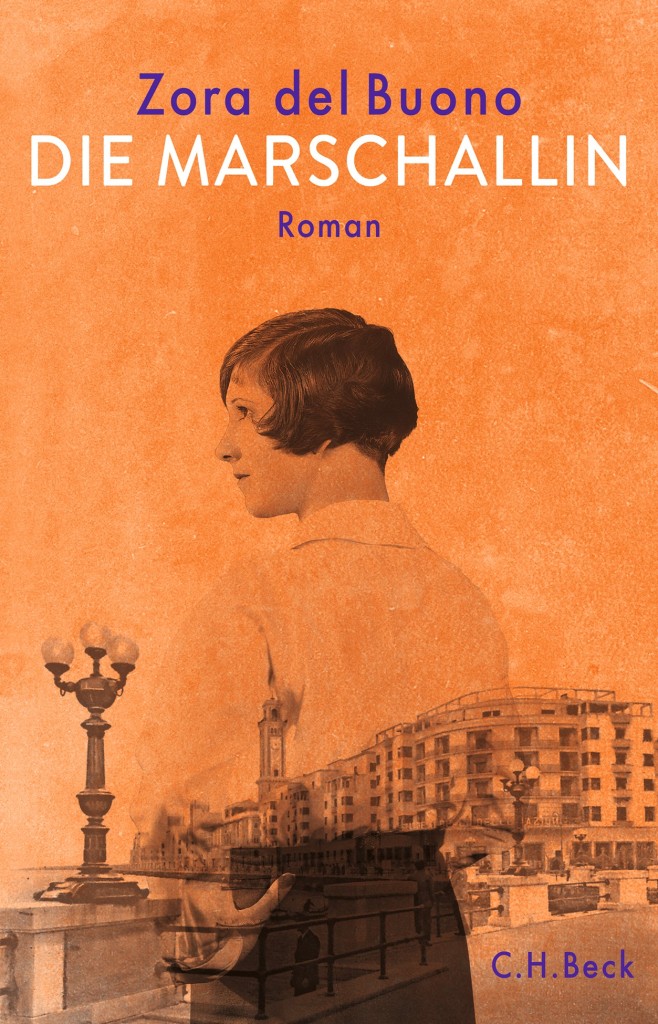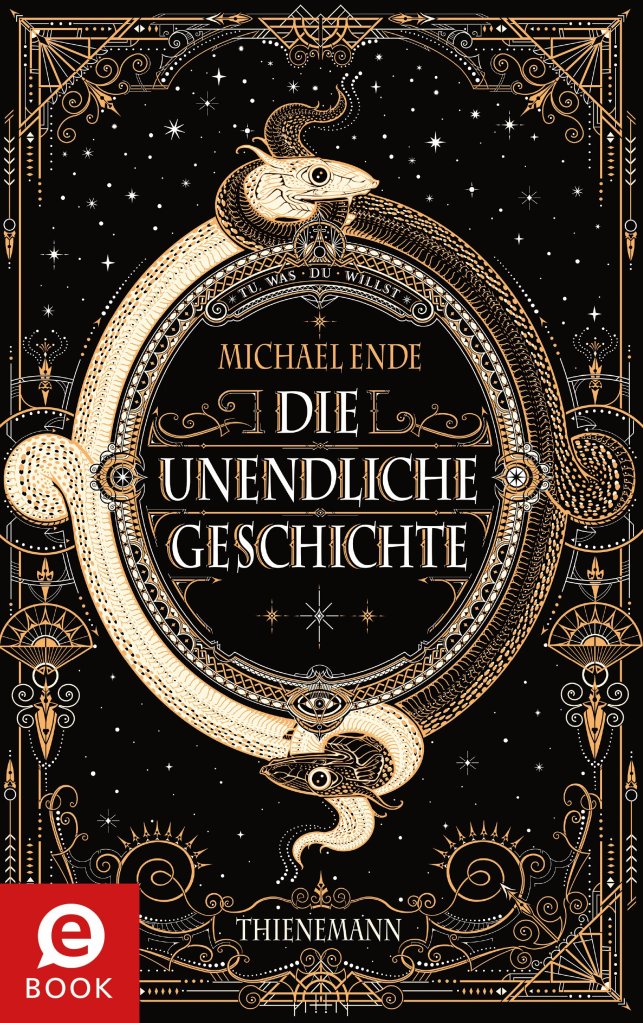Was hat eigentlich die Protagonistin in Zora del Buonos Roman “Die Marschallin” mit der roten Zora aus dem Jugendbuch von Kurt Held gemeinsam?
Die rote Zora als Gefährtin im Geiste
Die rote Zora ist bekannt aus dem Jugendbuch “Die rote Zora und ihre Bande”. Zusammen mit einer Gruppe von Waisenkindern schlägt sie sich in einem kroatischen Küstenort durch. Was die zusammengewürfelte Bande zusammenschweißt, ist ihre Solidarität füreinander. Aber die Kinder haben auch Fürsprecher unter den Dorfbewohnern und treten mit ihnen gemeinsam für soziale Gerechtigkeit ein.
Im Roman “Die Marschallin” von Zora del Buono heißt die Protagonistin ebenfalls Zora, sie ist die Großmutter der Autorin. Diese Zora hat einiges mit Kurt Helds Bandenanführerin gemeinsam. Beide stammen aus dem Gebiet, das einmal Jugoslawien war, und beide mussten als Kinder den Verlust ihrer Mutter verkraften. Vielleicht wurde gerade durch diese Erfahrung das Talent zur Anführerin geweckt. Nicht zufällig trägt der Roman von Zora del Buono den Titel “Die Marschallin”, denn die Großmutter der Autorin, die ebenfalls Zora Del Buono (allerdings mit großem “Del”) heißt, behielt stets das Kommando über ihre Familie — sowohl über ihre vier Brüder als auch über ihre drei Söhne. Dieses Kommando ging so weit, dass Zora die Schwiegertöchter für ihre Söhne aussuchte. Das Kriterium, das ihr dabei als Richtschnur diente, war, dass die Schwiegertöchter selbst keine Mütter haben sollten. Zora war von einem grundsätzliches Misstrauen gegenüber Frauen geprägt und wollte das weibliche Personal ihrer Familie gering halten.
Genossen unter sich

Zur Bande von Zora Del Buono gehörten solche kommunistischen Gründungsfiguren wie Antonio Gramsci und Josip Broz Tito. Zora war eine glühende Kommunistin. Diese Passion für den Kommunismus teilte sie mit ihrem Ehemann, dem sizilianischen Radiologen Pietro Del Buono. Die beiden lernten sich 1919 in der slowenischen Stadt Bovec im Soča-Tal kennen. Nach dem ersten Weltkrieg gehörte dieser Teil der ehemaligen K.-u.-k-Monarchie zu Italien.
Einige Zeit verbrachten Zora und Pietro zusammen mit ihren Söhnen in Berlin, wo Pietro an der Charité beschäftigt war. Die meiste Zeit über lebten die Del Buonos jedoch in der süditalienischen Stadt Bari, wo Zora eigens ein Palazzo entwarf, das sowohl als Residenz wie auch als radiologische Klinik fungierte. Während ihr Mann also im Untergeschoss eine Klinik betrieb, beschäftigte sich Zora im Obergeschoss damit, das Schicksal ihrer Familie zu spinnen.
Glanzzeiten und Schicksalsjahre
Ein Einzelschicksal ist nicht ohne die Zeitgeschichte zu denken. So sind die Ereignisse im Leben der Buonos eng mit den politischen Umwälzungen ihrer Zeit verwoben. Während des italienischen Faschismus sympathisierten Zora und Pietro mit den Partisanen und ein besonderes Ereignis war der Besuch Titos im Palazzo der Familie. Um diesen Besuch und eine vermeintliche Krankheit Titos rankt sich eine gern tradierte Familienanekdote.
Für den Roman wird aber ein anderes Datum zu einem Kristallisationspunkt. Am 24. Juli 1948 ereignete sich ein Verbrechen, in das die Del Buonos verstrickt waren. Für Zora Del Buono resultierte daraus ein Schuldgefühl, das sie bis zu ihrem Tod verfolgte. 1948 war auch das Jahr, in dem die Del Buonos aus der Kommunistischen Partei Italiens ausgeschlossen wurden. Das Großbürgertum war fortan nicht mehr als Parteimitglied gefragt.

Der letzte Teil des Romans wird in Form eines Monologs der Großmutter erzählt. Zora Del Buono lebte bis zu ihrem Tod 1980 in einem Seniorenwohnheim in der Stadt Nova Gorica, Jugoslawien. Von den mondänen Jahren in Bari scheint an ihrem Lebensabend nicht viel geblieben zu sein. Auch den frühen Tod ihrer Söhne musste sie verkraften.
In einem schwer nachvollziehbaren Gedankengang deutete sie den Tod ihrer Söhne als Strafe einer höheren Macht. Aus dem Schuldbekenntnis, für den Tod der Söhne verantwortlich zu sein, spricht eine Selbstüberschätzung, aber zugleich ein Bewusstsein für das eigene Scheitern. Das Schicksal ist nicht zu steuern und unterwirft sich auch nicht dem Diktat einer Marschallin.
Ein starkes Porträt
Der Roman “Die Marschallin” zeichnet im Kern das Porträt einer willensstarken und resoluten Frau, deren Biografie jedoch Brüche und Widersprüche offenbart, die sie zu einer eindrucksvollen Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts machen.
Zora del Buono: Die Marschallin, C. H. Beck 2020, ISBN: 978–3‑406–75482‑1, gebunden, 24 Euro.